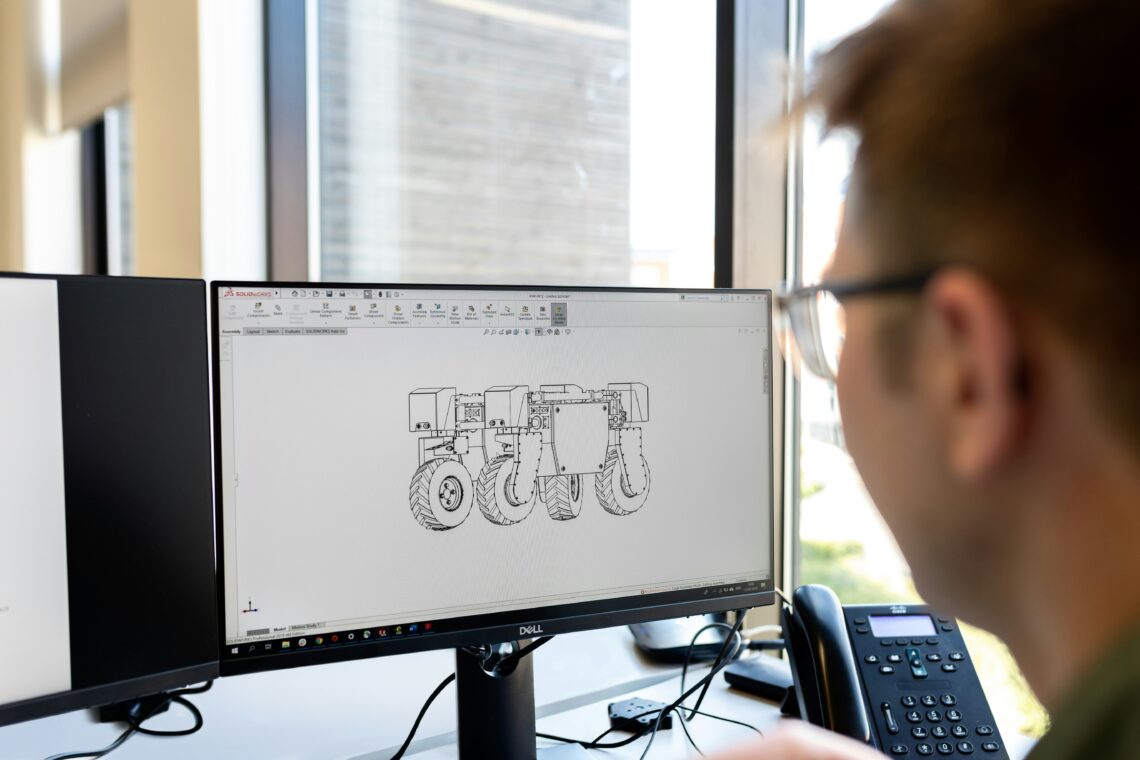KI für KMU: „Wer jetzt nicht anfängt, holt das später kaum noch auf“
„Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz birgt auch für kleine und mittelständische Unternehmen große Potenziale. Allerdings gibt es dort noch große Defizite beim Wissen um praktische Umsetzung, rechtliche Aspekte und Risiken“, sagte Professor Dr. Eckhard Koch auf der Auftaktveranstaltung zur „KI-Reise“ im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Rund 200 Geschäftsführende und Führungskräfte aus ganz OWL waren zu dem von der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Paderborn im Rahmen des von it’s OWL imitierten Kompetenzentrum Arbeitswelt.Plus bereits zum zweiten Mal organisierten ‚KI-Frühstück‘ gekommen, um sich über aktuelle KI-Technologien und -Anwendungen zu informieren.
„Ergänzend zur Lehre haben wir in den vergangenen Jahren einen sehr praxisorientierten Forschungsbereich aufgebaut, darunter auch den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz,“ berichtete der FHDW-Präsident und Leiter für Forschung, Entwicklung und Transfer. Derzeit arbeite die FHDW mit Unternehmenspartnern an Projekten wie Deichüberwachung, Drohneneinsatz für den Waldschutz, Optimierung von Service-Hotlines, Wissensmanagement und KI-unterstützte Wundbewertung in der Pflege.
„Unsere Forschung ist sehr anwendungsorientiert. Am Ende eines Projekts kommt immer ein praktisch einsetzbares Produkt heraus“, betonte Koch. „Dieses KI-Know-how tragen wir mit unserer vom Bundesforschungsministerium geförderten Veranstaltungsreihe nun in die Unternehmen.“
Jetzt starten – sonst wird es schwer aufzuholen
„Wer jetzt nicht anfängt, sich mit Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, kann das später kaum noch aufholen“, stellte Professor Dr. Christian Ewering klar. Der Dekan für Informatik bei der FHDW, zuständig für KI-Leuchtturmprojekte, vermittelte einen umfassenden Überblick über KI-Technologien und deren Anwendungen. „Grundsätzlich müssen Prozesse durch KI anders gedacht und Probleme anders angegangen werden“, sagte er.
KI-Systeme zur Prognose, Klassifizierung und Generierung könnten oft bessere und leistungsfähigere Lösungen realisieren. Allerdings steige mit der Modellqualität auch der Trainingsaufwand. Die Qualität hänge etwa von der Anzahl und Aktualität der Dokumente ab. „Da KI ein statistisches System ist, hat dies natürlich auch statistische Fehler“, gab Ewering zu bedenken. So müssten die Aussagen von generativen Systemen je nach Anwendungsfall überprüft werden. „Ich würde zum Beispiel nicht mit einem ausschließlich durch KI-gesteuerten Flugzeug fliegen“, scherzte er.

Kleine Schritte statt großer Sprünge
„Starten Sie den KI-Einsatz in Ihrem Unternehmen mit kleinen, vernünftigen Schritten, indem Sie einen ersten Anwendungsfall definieren“, riet der KI-Spezialist. „Sammeln Sie dabei Erfahrungen und holen sich für den Anfang externes Know-how dazu.“ Entscheidend seien dabei ausreichend personelle Kapazitäten und echte KI-Kompetenz. „Unsere Studierenden im Fachbereich ‚Künstliche Intelligenz & Data Science‘ haben sich bis zu ihrem Abschluss bereits rund 1600 Stunden mit KI und KI-relevanten Themen beschäftigt.“
Praxisbericht: KI-Integration bei Phoenix Contact
Aus der Praxis berichtete Thomas Bischoff über die strukturierte Einführung der KI-Nutzung bei Phoenix Contact in Blomberg. Das Unternehmen nutzt KI-Anwendungen unter anderem für die Optimierung von Produktion und Vertrieb, im administrativen Bereich oder zur Videoübersetzung. „Doch wer nur die Anwendungsfälle sieht, denkt nicht weit genug“, machte der Corporate AI Manager deutlich. Um den konformen Einsatz von generativer KI zu ermöglichen, habe man 2023 ein eigenes Kompetenzteam mobilisiert.
„Für Unternehmen sind die Chancen durch die Nutzung von KI riesig, allerdings gibt es auch Pflichten, beispielsweise im Hinblick auf den Europäischen AI-Act“, begründete Bischoff das aufwändige Vorgehen. So wurde von Anfang an auch der Betriebsrat einbezogen. „Bei Phoenix Contact haben wir gemeinsam für den Einsatz generativer KI eine unternehmensweit gültige Richtlinie erarbeitet und setzen gleichzeitig auf den transparenten Umgang mit KI“, berichtete Bischoff. „Hier wird unter anderem die Einführung neuer KI-Anwendungsszenarien durch klar definierte Prozesse geregelt.“ Eine besondere Bedeutung habe zudem die regelmäßige und intensive Kommunikation mit allen Mitarbeitenden. „Das ist zwar aufwändig, aber unverzichtbar.“
Rechtliche Unsicherheiten bleiben
„Bei der rechtlichen Bewertung können wir heute nur an der Oberfläche kratzen“, betonte Dr. Daniel Wittig von der Paderborner Kanzlei Brandi. Der Fachanwalt für IT-Recht machte deutlich, dass rund um die KI immer noch viele Fragen offen seien. „Wir müssen also eigentlich immer den Einzelfall betrachten.“ Für die rechtliche Bewertung des KI-Einsatzes in Unternehmen seien verschiedene gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten.
„Eine davon ist die Datenschutzgrundverordnung, denn weil die KI zum Training möglichst große Datenmengen benötigt, besteht hier erst mal ein grundsätzlicher Konflikt.“ Prinzipiell erlaube die Verordnung die Verwendung personenbezogener Daten nämlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen. „Bei KI-Projekten sollte der Datenschutz deshalb unbedingt von Anfang an mitgedacht werden.“
Der AI-Act und zukünftige Haftungsfragen
Wittig informierte außerdem über das neue EU-Gesetz „Artificial Intelligence Act“, das den Einsatz und die Vermarktung von Künstlicher Intelligenz für die gesamte EU einheitlich regelt. Wesentliche Bestimmungen und Verbote gelten seit dem 2. Februar 2025, weitere werden bis August 2027 schrittweise umgesetzt. „Für KI-Systeme gelten entsprechend ihrer Risikoeinstufung neue Rahmenbedingungen: vom Einsatz ohne Regulierung, über Regulierung und Transparenzpflicht, bis hin zum Verbot“, erläuterte er. „Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihre Anwendung in den unregulierten Minimalrisikobereich fällt, sondern führen Sie unbedingt eine Risikoabwägung durch.“
Wittig wies darauf hin, dass insbesondere für die Nutzung generativer KI auch die Auseinandersetzung mit urheberrechtlichen Fragen und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen notwendig sei. „Wichtig für Unternehmen wird in Zukunft außerdem die neue KI-Haftungsrichtlinie, die sich derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren befindet“, schloss er. „Unter anderem wird dieses Gesetz Geschädigten die Beweispflicht durch eine Offenlegungsverpflichtung und eine zu widerlegende Kausalitätsvermutung ganz wesentlich erleichtern.“
Weiterführende Veranstaltungen für Unternehmen
Im Rahmen der KI-Reise finden bis Juni weitere kostenfreie Veranstaltungen zu speziellen Schwerpunkten für Verantwortliche aus dem Personal-, Cyber-Security- und Kreativ-Bereich statt. Informationen zur gesamten ‚KI-Reise‘ unter www.fhdw.de/KI